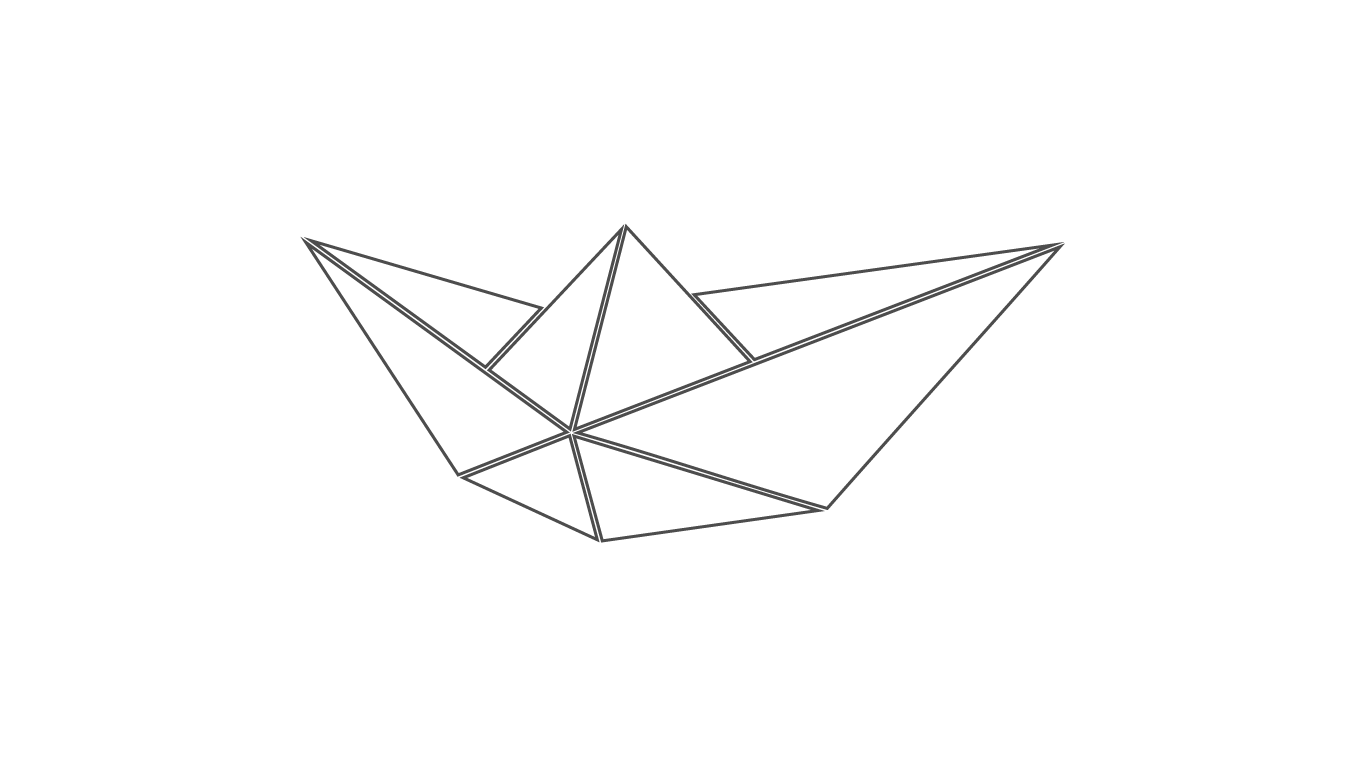Vor einigen Tagen hat Miriam Lochner auf ihrem Blog auxkvisit.de unter dem Titel »Gendern mit dem generischen Maskulinum? Ein auxkvisiter Versuch« einen Beitrag zu geschlechtergerechter Sprache veröffentlicht. Er enthält einige Aussagen zum Thema, an denen ich mich stark stoße, die aber sehr, sehr häufig zu hören (in privaten Umfeldern) und zu lesen (von vorgeblich kulturbeflissenen Feuilleton-Redakteur*innen) sind. Dieser Text ist nicht direkt eine Replik auf Miriams Beitrag, viel mehr eine Auseinandersetzung mit Gedanken, die ich beim Lesen des Textes und verschiedener Gespräche unter dem dazugehörigen Instagram-Post hatte. Ich hätte zu diesem Text wirklich sehr viele Anmerkungen, aber ich beschränke mich auf wenige Aspekte.
Vorweg: Für gewöhnlich nehme ich an solchen Diskussionen nicht teil. Es werden ständig die gleichen Argumente gesetzt, die schon zig-Mal besprochen, widerlegt und wieder angesprochen wurden, aber natürlich habe ich auch Gedanken dazu.
Ich predige hier nicht und will niemanden bekehren. Die Verwendung gendersensibler Sprache ist eine individuelle Entscheidung, die alle Menschen selbst für sich treffen müssen. Corporate Policy ist da natürlich ausdrücklich nicht mitgemeint, professionelle Kommunikation läuft ohnehin etwas anders.
Absolut nichts hindert Menschen daran, geschlechtergerechte Sprache zu verwenden – oder eben auch nicht. Und dabei könnte man es einfach belassen und mal spekulieren, wie wir das mit der Erderwärmung denn nun wirklich in den Griff kriegen. Stattdessen fangen in aller Regelmäßigkeit Feuilletons und sog. Intellektuelle immer wieder an, sich darüber zu echauffieren. Wir können mittlerweile die Uhr danach stellen.
Prinzipiell finde ich diese Debatte albern und ich denke, wir alle haben eigentlich Besseres zu tun, als uns immer wieder mit den selben Themen auseinanderzusetzen. Das verstellt den Blick aufs Wesentliche, nämlich den Gesamtscheiß, der gerade so vorgeht. Pandemien, die Klimakatastrophe, Menschenrechtsverletzungen durch die Europäische Union, Korrupte Deals von Mitgliedern der deutschen Parlamente, dies, das.
Sprache prägt Wahrnehmung
Ich benutze geschlechtergerechte Sprache, so gut es geht. Beruflich sowieso, aber eben auch im privaten Alltag, in Texten, in Tweets und auch in gesprochener Sprache. Ich finde das wichtig, denn Sprache prägt Wahrnehmung. Das ist nicht einfach lapidar dahergesagt. Expert*innen aus Linguistk, Psychologie und Kognitionswissenschaften haben das seit Jahrzehnten immer wieder untersucht und bestätigt (Stahlberg und Sczesny (2001), De Backer und De Cuypere (2012)).
Aus der Forschung wird ganz klar, dass es eben nicht »nur um Menschen« geht, das tut es nie. Der deutschen Umgang mit der (Un-)Sichtbarkeit der Geschlechter (das »generische Maskulinum«) stammen aus einer Zeit, in der Frauen gesellschaftlich als Individuen kaum sichtbar waren. Sprachliche Repräsentation war damit auch nicht nötig.
Sog. Sprachschützer [hahah, Sprache schützen, einfach eine komplett lächerliche Idee] verteidigen das generische Maskulinum als »neutrale Form« im Deutschen, gern auch mal als »natürlich«. An der Ausprägung von Sprache ist dabei eigentlich nichts natürlich und auch nicht neutral. Sprache ist kulturell bedingt, nicht durch die Natur.
Dadurch ist es sehr schwierig, lebendige Sprachen einzufangen, weil sich Sprache eben entwickelt. Das ist auch den meisten Leuten klar, die damit arbeiten.1 Was wir gerade mit geschlechtersensibler Sprache erleben, ist ein Aushandlungsprozess darüber, wie alle Geschlechter am besten in einer Sprache abgebildet werden, die mit grammatischen Geschlechtern agiert. Ich finde das total spannend, weil wir die Lebendigkeit von Sprache an diesem Beispiel sehr direkt erfahren.
Der Duden
Dass der Duden da nur sehr bedingt eine Referenz sein kann, muss vielleicht auch noch ein mal klar gezogen werden. Der Duden wird zwar „auf Grundlage der amtlichen Rechtschreibregeln“ erstellt, wirkt aber nicht aktiv auf die Formung von Sprache ein – der Duden bildet lediglich die Realität von Sprache ab. So kommt es, dass sehr häufig Begriffe herausfallen und neue aufgenommen werden. 2020 wurden etwa Begriffe wie Reproduktionszahl und Shutdown aufgenommen, zusammen übrigens mit einer Übersicht über Geschlechtergerechten Sprachgebrauch.
Deine Uni ist ein Turm aus Elfenbein
Ein besonders dankbares Ziel für Spott sind in diesem Zusammenhang natürlich Universitäten. Grob umrissen steht die Universität im liberal-konservativen Diskurspanorama der deutschen Zeitungen für den Elfenbeintum™. Dort denken sich Akademiker*innen ständig irgendeinen abgehobenen Scheiß aus und forschen völlig an der Realität der deutschen Normalbürger™ vorbei. Dazu passt natürlich, dass Unis im Allgemeinen schon seit Jahrzehnten ihre Studis als »Studierende« anreden und allein das ist für manche Helmuts schon zu viel.
Es wird immer wieder behauptet, dass Unis die Verwendung von geschlechtergerechter Sprache als Anforderung stellen würden und dass Studierende, die nicht gendern, Nachteile zu befürchten hätten, wie etwa eine schlechtere Note. Ich habe erlebt, dass sich Lehrstühle an ein und derselben Fakultät häufig schon nicht untereinander einig werden können, wie genau jetzt eigentlich zitiert werden soll. Und das ist auch okay. Aber wie genau Unis in diesem Kontext geschlechtersensible Sprache vorschreiben sollen, kann ich mir nicht recht vorstellen.
Der Linguist Anatol Stefanowitsch hat im Februar 2021 sogar ein Preisgeld von 100 Euro für einen schriftlichen Beleg geboten, der Repressalien gegen Studierende nachweist, die Hausarbeiten nicht gendergerecht abgefasst haben.
Ich setze deshalb eine Belohnung von 100€ aus, für die erste Person, die mir einen solchen Fall vorlegen kann. 2/
— Anatol Stefanowitsch (@astefanowitsch) February 25, 2021
Dazu muss gesagt werden, dass »Repressalien« doch etwas deutlich anderes sind, als Vorgaben in einem Styleguide, an den sich Studierende ja trotzdem noch zu halten haben. Styleguides regeln Zitation, Schriftgrad oder die zu verwendende Schriftart.
Stefanowitsch musste bisher übrigens noch nicht ein mal zahlen, weil sich die medial aufgeblasenen Fälle (die auch vom VDS befördert wurden) bisher durchwegs als Falschdarstellungen erwiesen haben.
Die Rolle der Typographie
Zuletzt noch ein paar Sätze zur Gestaltung gendergerechter Inhalte. Sehr häufig wird behauptet, geschlechtergerechte Sprache führte zur schlechteren Lesbarkeit. Einerseits gibt es dazu aus der Forschung keine Ergebnisse, die diese These unterstützen (siehe etwa Braun et. al (2007)). Andererseits finde ich solche Argumente erstaunlich, besonders wenn sie von Typograph*innen kommen. Sie tun das auch intensiv, etwa Friedrich Frossmann (2021), der mit seinen Positionen komplett lost ist, wie ich finde.
Wenn es um Lesbarkeit geht, kommt der Typographie eine entscheidende Rolle zu. Wenn ein Text schlecht lesbar ist, haben die Gestalter*innen einen schlechten Job gemacht – ganz egal, ob der Text gendert oder nicht.
Eine Anekdote.
Vor ein paar Jahren war ich dabei, als eine Gestalterin ein fertig designtes Logo für ein größeres Projekt vorstellte. Eine Wort-Bild-Marke, deren Bestandteil auch ein š war, ein S mit Hatschek, der häufig in slawischen oder baltischen Sprachen vorkommt und wie »sch« ausgesprochen wird. Die Gestalterin hat nun »aus ästhetischen Gründen« ohne wirklich ohne jegliches Gespür für das, was Sprache eigentlich ausmacht, darauf verzichtet, den Hatschek korrekt abzubilden. Sie hat stattdessen ein »ś« verwandt, ein S mit Akut, das in der betroffenen Sprache – dem Tschechischen nämlich – gar nicht vorkommt.
Typographie ist ein Werkzeug für Sprache. Sie bildet Sprache ab und ist genau so veränderbar – das Unflexibelste daran sind ihre Gestalter*innen, ganz ohne Zweifel. Es wäre ihre Aufgabe, Mittel und Wege zu entwickeln, die Besonderheiten von Sprache abzubilden, statt offensichtlich notwendige Veränderungen mit simplen Geschmacksurteilen abzubügeln.
Erste produktive und interessante Ansätze dazu liefern beispielsweise das How to Genderstern in Typografie und Schriftgestaltung, oder die Typographin Bianca Ledies in ihrem Bachelorprojekt Nonbinäre Typo.
- Tatsächlich sind auch tote Sprachen nicht ganz tot. Die Päpstliche Akademie für die Lateinische Sprache kümmert sich beispielsweise darum, dass das Lateinische als Amtssprache des Vatikan mit dem modernen Italienisch mithält. Ihre Vorgänger-Organisation hat uns etwa die lat. Übersetzungen für Basketball [follis canistrique ludus], Kondome [tegumenta] und Videotheken [pellicularum cinematographicarum thecae] geschenkt.